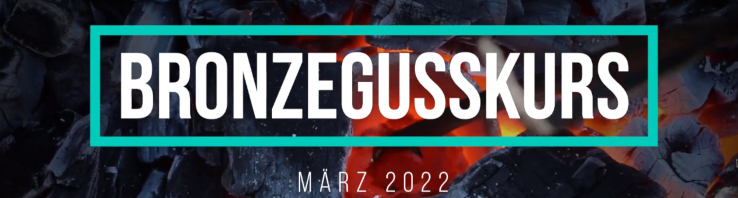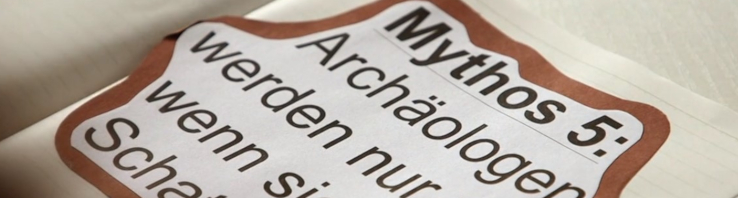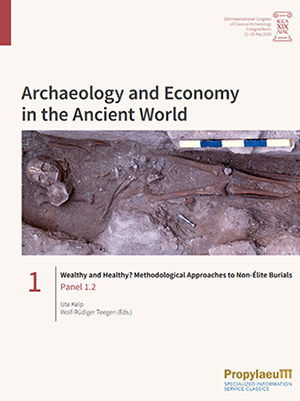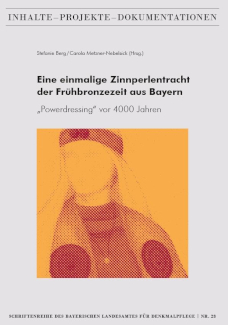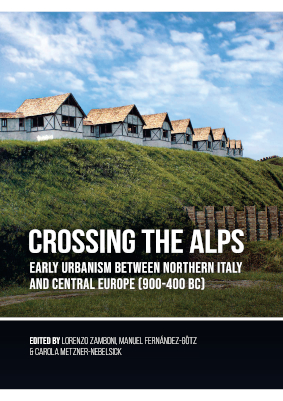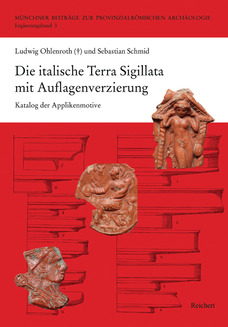Aktuelles, Vorträge und Publikationen
Aktuelles
Vorträge und Gastvorträge
Instituts- und Fachschaftsvorträge:
Poster und Programme durch Klick auf den Link unter den entsprechenden Bilder erhältlich
Mittwoch, 26.11.2025, 18:00 Uhr c.t., Hörsaal M 105 (LMU Hauptgebäude): The oppidum of Bibracte in Burgundy, 1st c. BC: witness of a world in transition - Dr. Vincent Guichard (Directeur généra, Centre Archéologique Euopéen de Bibracte)
Mittwoch, 03.12.2025, 18:00 Uhr c.t., Hörsaal M 105 (LMU Hauptgebäude): Plant foods of prehistoric Greece: from daily staples to foods for special occasions - Prof. Dr. Soultana Valamoti (Aristoteles Univeristy Thessaloniki)
Mittwoch, 28.01.2026, 18:00 Uhr c.t., Hörsaal M 105 (LMU Hauptgebäude): Zwischen Parthien und Rom. Barbarische Eliten der nördlichen Schwarzmeerraumes vom 3. Jh. v. Chr. bis zur Mitte des 3. Jhs. n. Chr. - Dr. Valentina Mordvintseva (Vortrag zum Abschluss des Habilitationsverfahrens)
ABC-Vorträge (öffentliche Vortragsreihe):
Hier der Link zum ArcheoBioCenter, dort finden Sie die Poster für die Vorträge als pdf.
Die Fachschaft der VFPA hat einen neuen Studienführer erstellt, der einen Überblick über das Studium der Vor- und Frühgeschichtlichen sowie Provinzialrömischen Archäologie an der LMU gibt.
Eine Einführung und FAQs der LMU zur Teilnahme an Zoom-Meetings (digitale Lehrveranstaltungen) finden sie beim IT-Servicedesk.
Ein Einführungsvideo zur Teilnahme an Moodle-Kursen finden sie z.B. auf der Seite der Fakultät für Geowissenschaften.
Informationen für Erstsemester zur Nutzung der Universitätsbibliotheken:
- Aktuelle Informationen der UB
- Vorstellung der Universitätsbibliothek und ihres Bibliothekssystems sowie der aktuellen Nutzungsbedingungen in einer achtminütigen Präsentation
- Informationen zu den Standorten der Universitätsbibliothek mit einem filmischen Rundgang durch die Zentralbibliothek
- Eine filmische Erläuterung der Mediennutzung in den Fachbibliotheken
- Hinweise zur Literatursuche
- Hinweise zur Benutzung der Bibliotheken während der Corona-Pandemie
- Hinweise zu E-Tutorials und Webinaren
- Kontaktadresse der UB
- Die Bibliothek des Historicums hat eine Handreichung zur Bibliothek herausgegeben
Die digitalen Übertragungen der Lehrveranstaltungen via Zoom dürfen nicht aufgezeichnet und weiterverbreitet werden, sofern nicht anders mit der/dem Lehrbeauftragten abgesprochen! Andere Online-Inhalte zu Veranstaltungen (z.B. Moodle) dürfen ebenfalls nicht ohne Erlaubnis verbreitet werden und sind lediglich für den persönlichen Studienzweck zu nutzen.
Falls Fragen zum technischen Ablauf/Voraussetzungen der digitalen Lehre bestehen, bitte wenden sie sich an Dr. Ken Massy (ken.massy@vfpa.fak12.uni-muenchen.de).
Film über die Lehrgrabung am Stätteberg 2024
Ein filmischer Kurzbericht von Lisa Pangratz über die Lehrgrabung auf der mittelbronzezeitlichen Befestigungsanlage vom Stätteberg, Lkr. Neuburg a. d. Donau von 2024 unter der Leitung von Prof. Dr. Carola Metzner-Nebelsick und Prof. Dr. Louis D. Nebelsick. Die Lehrgrabung bietet den Studierenden die Möglichkeit an einer Forschungsgrabung teilzunehmen, alle Grabungs- und Dokumentationstechniken zu erlernen und sich zu vernetzen. Weitere Informationen zu den Befunden und Forschungsergebnissen finden sie hier.
Um den Film anzusehen, einfach auf das Bild klicken.
Bericht über die Prospektions- und Vermessungsübung vom 9.-13. Oktober 2023 am Archäologiepark Belginum
Eine gemeinsame Veranstaltung der Universität Trier und der LMU München (Leitung: Rosemarie Cordie, Rebecca Retzlaff, Johannes Stoffels und Wolf-Rüdiger Teegen). Seit mehreren Jahren führen die Klassische Archäologie, Geoinformatik und Umweltfernerkundung der Universität Trier und das Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömische Archäologie der LMU München eine gemeinsame Prospektions- und Vermessungsübung im römischen Vicus Belginum durch. Ziel dieser Surveys ist die genauere Bestimmung der Ausdehnung der antiken Besiedlung. An der Veranstaltung nahmen zehn Studierende der Geoinformatik, Umweltfernerkundung und Geoarchäologie teil. Um sich den ganzen Bericht anzusehen, einfach auf das Bild klicken.
Die Interpretationen der Studierenden ist auch in Form einer Story-Map der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Imagefilm des Instituts
Das Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömischen Archäologie und seine Professorinnen und Professoren stellen sich vor. Ein YouTube-Film von Tomas Simeth und Max Fiederling. Einfach auf das Bild klicken und anschauen.
Bronzegussworkshop am Bajuwarenhof in Kirchheim
Videozusammenfassung mit Erläuterungen zum Bronzegussworkshop im März 2022. Aufbauend auf eine Lehrveranstaltung am Institut für Vor- und Frühgeschichtliche Archäologie und Provinzialrömischen Archäologie im Wintersemester 2021/2022 (Bronzeguss und Toreutik – Vom Erz bis zum Fertigprodukt), durchgeführt von Dr. Ken Massy, wurden einzelne Aspekte des Bronzegusses und der Kupferblechverarbeitung im Workshop experimentell nachempfunden. Ein YouTube-Film von Tomas Simeth und Ken Massy, Workshopleiter: Johannes Goldes (Moosburg a. d. Isar), Veranstaltungsort: Bajuwarenhof in Kirchheim b. München. Einfach auf das Bild klicken und anschauen.
Fernsehbericht
Mythos Archäologie: Zwischen Indiana Jones und Völkerkunde-Museum
Ein Bericht in ARD-alpha mit Frau Prof. Dr. Carola Metzner-Nebelsick und Julia Hochholzer. Einfach auf das Bild klicken und anschauen.
Publikationen
Neu im Jahr 2022 erschienen:Kelp, Ute und Teegen, Wolf-Rüdiger (Hrsg.): Wealthy and Healthy? Methodological Approaches to Non-Élite Burials Panel 1.2, Heidelberg: https://doi.org/10.11588/propylaeum.926 Der Band kann über den angegebenen DOI kostenfrei heruntergeladen werden. |
|
Neu in den Jahren 2020/2021 erschienen:
|
Stefanie Berg, Carola Metzner-Nebelsick (Hrsg.) Anlass für einen Versuch, der klären sollte, wie in der frühen Bronzezeit sehr kleine Zinnperlen mit Durchlochung hergestellt worden sein könnten, war die Entdeckung des Grabes einer jungen Frau, die vor über 4000 Jahren auf einer Lechterrasse in Schwabmünchen beigesetzt worden war: Mit winzigen Zinnperlen waren in sehr aufwändiger Form ein Cape und eine Haube bestickt worden, wie während der restauratorischen Bearbeitung festgestellt werden konnte. Eine bedeutsame Entdeckung, denn die Verarbeitung von Zinn war technologisch ein innovativer Schritt auf dem Weg zur Bronzeherstellung. |
|
|
Lorenzo Zamboni, Manuel Fernández-Götz, Carola Metzner-Nebelsick (Hrsg.) This volume offers the first comprehensive overview of the urbanisation processes that took place south and north of the Alps during the early first millennium BC, highlighting the interactions between the different geographical areas. |
|
|
Mario Gavranović, Daniela Heilmann, Aleksandar Kapuran and Marek Verčik (Hrsg. Volume 1) Die Reihe beruht auf einer neuen Konferenzserie, die künftig alle 2-3 Jahre auf dem Balkan stattfinden wird und deren erste Publikation 2016 als Godišnjak [Sarajevo] Bd. 47 erschienen ist. Dieser Tagungsband der zweiten Konferenz von 2017 in Belgrad enthält Vorwort, Prolog, Einleitung und 14 Aufsätze. Diese befassen sich mit der Interaktion in der M-SBZ des SW-Balkans, Ähnlichkeiten und Unterschieden der materiellen Kultur der Belegiš II-Gava Gruppe in Südpannonien und dem Marchbecken, Körperbestattungen versus Brandbestattungen in der SBZ zwischen S-Karpatenbecken und W-Balkan, Dalmatien in der SBZ-FEZ, Schutzwaffen der SBZ, der Siedlung von Čepintsi im SBZ-Kontext, Siedlungen und Gräberfeldern der FEZ in Makedonien, den Seevölkern und dem “Balkanismus” in der SBZ-Archäologie, kultureller Kontinutiät während der SBZ-FEZ im westlichen Marchbecken, Späthallstatt-Kontakten zwischen SO-Karpatenbecken und W-Balkan, Gürtelschmuck bei Frauen des 7./6. Jh. in N-Albanien, Grabsitten der EZ in N-Griechenland, “Monochromer Ware” in N-Griechenland von der Spätgeometrik bis zur Archaik sowie Objektbiographien zweier Metallgefäße aus einem Grab in Vergina / Aigai. |
|
Neu im Jahr 2024 erschienene Bände der Münchner Beiträge zur Provinzialrömischen Archäologie (Hrsg. M. Mackensen):
| Michael Mackensen Das severische Vexillationskastell Myd(---) und die spätantiken castra Madensia / Gheriat el-Garbia am limes Tripolitanus (Libyen). II Ausgrabungen und Untersuchungen im Kastell, im Steinbruch, in den Heiligtümern und am Beobachtungsturm 2009–2010. Mit Beiträgen von J. Eingartner (†), F. Schimmer, S. Schmid, M. Stephani u. a. MBPA 11,1.2 (Wiesbaden 2024) 2 Bände, 712 S., 17 Tab., 310 s/w- u. Farbabb. im Text, 34 Taf. (978-3-7520-0691-9) Das römische Kastell Gheriat el-Garbia liegt 280 km südlich von Tripolis in der Halbwüste, oberhalb einer Oase, an der zentralen Route in den Fezzan. Es ist – neben Bu Njem und Ghadames – das größte der unter Kaiser Septimius Severus weit nach Süden vorgeschobenen neuen Vexillationskastelle des limes Tripolitanus. Spätestens im Herbst 201 n. Chr. wurde es von einer Abteilung (vexillatio) der legio III Augusta aus Lambaesis (Algerien) fertiggestellt. Aufgabe der Besatzung war die Kontrolle und Sicherung der Verkehrswege und Karawanenrouten sowie die Überwachung der (semi-)nomadischen autochthonen Stämme.
|
|
|
Ludwig Ohlenroth (†)/Sebastian Schmid Der 1892 in Augsburg geborene und dort 1959 verstorbene Ludwig Ohlenroth war nicht nur über mehrere Jahrzehnte als Ausgräber und Denkmalpfleger vor allem in Augsburg und Kempten tätig, sondern beschäftigte sich auch intensiv mit römischer Keramik. Zahlreiche Reisen führten ihn in Museen u. a. in Deutschland und Italien, in denen er frühkaiserzeitliche bleiglasierte Gefäße, Aco-Becher und Sarius-Schalen zeichnete und katalogisierte. Im Zentrum seines Forschungsinteresses stand jedoch die applikenverzierte italische Terra Sigillata, insbesondere die als Dekor verwendeten Motive. Bereits in den frühen 1920er Jahren begann Ohlenroth mit der Sammlung und Dokumentation applikenverzierter italischer Sigillata. 1937 publizierte er einen Artikel zu dieser Ware, in dem er sich zwar auf die entsprechenden Belege aus Raetien und Germanien beschränkte, jedoch immer wieder auf seine darüber hinaus gehenden Untersuchungen Bezug nahm. Diese setzte er bis in die 1950er Jahre fort, ohne sie allerdings abschließen zu können. |
|